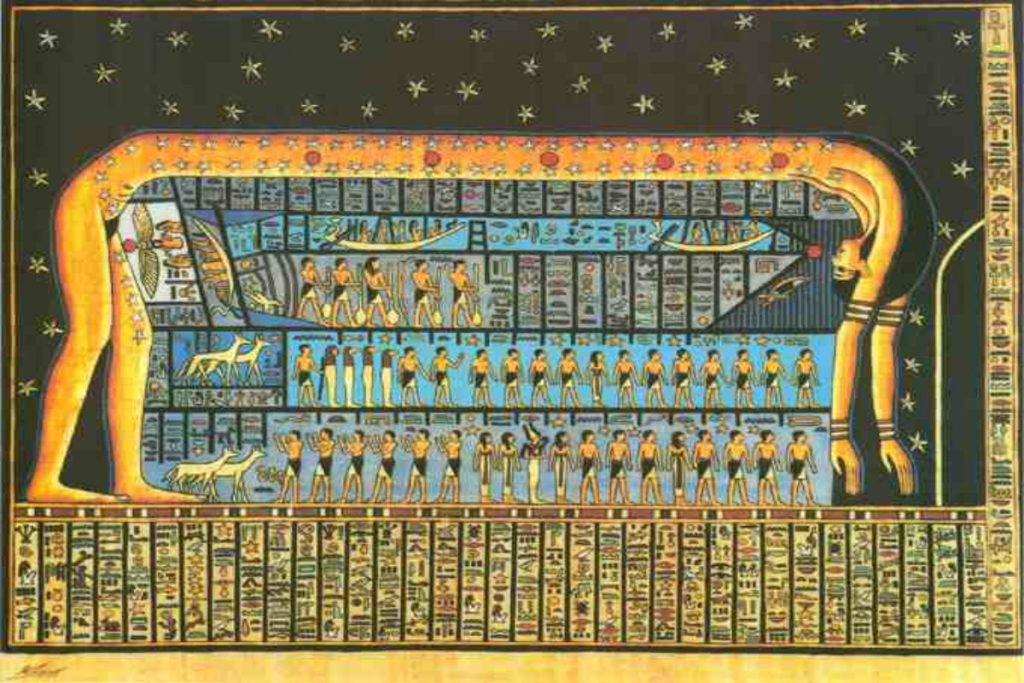Wenn wir an die kanadische Arktis denken, stellen wir uns einen der letzten unberührten Orte der Erde vor. Einen Ort, an dem die Natur von der Zivilisation unberührt bleiben sollte. Es stellt sich heraus, dass dies nur eine Illusion ist, die durch aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen endgültig zerstört wurde. Die Expedition, die sich eigentlich auf die Erforschung von Mikroorganismen konzentrieren sollte, brachte eine viel beunruhigendere Entdeckung zutage.

Untersuchungen in Cambridge Bay liefern beunruhigende Ergebnisse
Amerikanische Forscher haben das Vorhandensein mikroskopisch kleiner Plastikpartikel in einer Umgebung bestätigt, die bisher als frei von Verschmutzung galt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass das Problem der Mikroplastik ein Ausmaß erreicht hat, das wir uns bisher nicht vorstellen konnten. Ein Team der Vermont State University und der Castleton University verbrachte zwei Wochen im kanadischen Cambridge Bay im Rahmen des DRACO-Projekts. Ursprünglich konzentrierten sich die Wissenschaftler auf die Analyse von Mikroorganismen im arktischen Eis, doch dann wurde ihre Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes gelenkt. Bei der Untersuchung von Schnee-, Meereis- und Permafrostproben entdeckten die Forscher Plastikpartikel. Für die am Projekt beteiligte Studentin Olivia Rutkowski war dieser Moment besonders bedeutsam:
Die Feldarbeit erforderte von den Wissenschaftlern große Ausdauer. In der ersten Woche überwandten sie mit Schneemobilen eine mehr als zwei Meter dicke Eisschicht, um Orte zu erreichen, die 15 bis 45 Minuten Fahrtzeit von der Basis entfernt waren. Die zweite Woche widmeten sie der Entnahme von Permafrostkernen – eine Arbeit, die manchmal viele Stunden in Anspruch nahm. Andrew Vermili, der einen Teil der Untersuchungen zu Mikroplastik leitete, erklärt die Mechanismen des Transports dieser Verunreinigungen:
Wenn Plastik zerfällt, kann es dorthin transportiert werden. Man kann es im Eis und im Wasser sehen – und es kann dort für lange Zeit verbleiben
Experten unterscheiden drei Hauptwege, über die Mikroplastik in die Polarregionen gelangt. Dies sind Meeresströmungen, atmosphärische Zirkulation und Niederschläge. Die globalen Verbindungen zwischen den Ozeanen ermöglichen den Transport von zerfallendem Plastik über enorme Entfernungen. Darüber hinaus gelangen bei der Verbrennung und Verarbeitung von Kunststoffen mikroskopisch kleine Partikel in die Atmosphäre und setzen sich dann zusammen mit den Niederschlägen ab.

Mögliche Folgen für die Umwelt und den Menschen
Das Vorhandensein von Mikroplastik in arktischen Ökosystemen kann weitreichende Folgen haben. Wenn gefrorene Partikel schmelzen und in den Ozean gelangen, werden sie Teil der marinen Nahrungsnetze. Dies stellt eine Gefahr für Fische, Seevögel und lokale Gemeinschaften dar, die von diesen Ressourcen abhängig sind. Für den Menschen birgt der Kontakt mit Mikroplastik konkrete Gesundheitsrisiken. Das Einatmen oder Verschlucken dieser Partikel kann zu Entzündungsprozessen, Atemproblemen und möglichen Langzeitfolgen führen, die noch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sind. Die Expedition nach Cambridge Bay war bereits die vierte Feldmission im Rahmen des DRACO-Projekts. Frühere Untersuchungen wurden in Fairbanks (Alaska), Kangerlussuaq (Grönland) und Utqiaqvik (Alaska) durchgeführt. Jeder Standort liefert einzigartige Daten über die Verbreitung von Mikroplastik in abgelegenen Ökosystemen.
Auf dem Campus in Castleton entwickeln Studenten neue Methoden zum Nachweis und zur quantitativen Bestimmung von Mikroplastik in Boden und Wasser. Die Arbeit des DRACO-Teams trägt dazu bei, Karten zur Verbreitung dieser Verschmutzungen in abgelegenen Ökosystemen zu erstellen und liefert Daten, die für die Entwicklung künftiger Reinigungs- und Präventionsstrategien erforderlich sind. Obwohl der Nachweis von Mikroplastik in der kanadischen Arktis nicht gerade optimistisch stimmt, liefert er wertvolle Daten für weitere Untersuchungen. Die Wissenschaftler planen die nächste Sommerexpedition für 2026, wahrscheinlich auf die Insel Ellesmere in Kanada oder nach Nordgrönland.
In der Zwischenzeit fordern Wissenschaftler und Umweltgruppen dazu auf, den Verbrauch von Plastik wo immer möglich zu reduzieren. Der Verzicht auf Einwegverpackungen zugunsten von Mehrwegbehältern scheint ein sinnvoller erster Schritt zu sein. Die Entdeckung in Cambridge Bay ist ein weiteres Zeichen dafür, dass das Problem der Plastikverschmutzung globale Ausmaße erreicht hat. Selbst die entlegensten Winkel unseres Planeten sind nicht mehr frei von Spuren menschlicher Aktivitäten. Die Frage, ob es uns gelingen wird, diesen Trend zu stoppen, bleibt offen, aber jedes neue Wissen bringt uns der Suche nach einer Lösung näher.